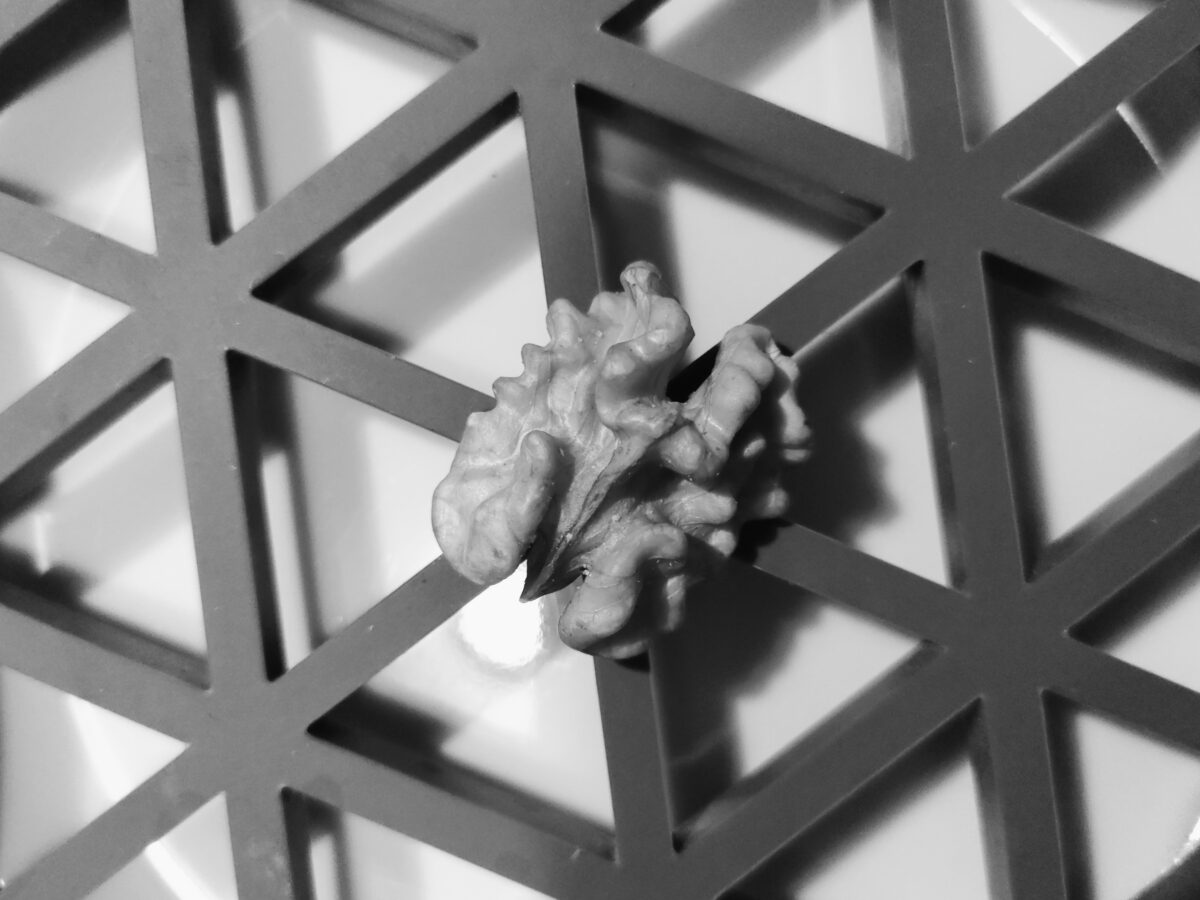Tabea Mantsch öffnet Schränke in fremden Wohnungen. Die Mitarbeiterin der Kinderspitex füllt Spritzen, wechselt Verbände und streichelt Babyhaare.
Erschienen am 27.12.2022 im «Bieler Tagblatt»
«Ich schätze es sehr, im Auto unterwegs zu sein. Hier habe ich Ruhe und kann mich auf das nächste Kind einstellen. Wir gehen nicht nur zu den Familien nach Hause. Manchmal gehen wir auch zu den Grosseltern, ins Heim, zu Pflegeeltern oder in die Schule – zum Beispiel für eine Blutzuckerkontrolle bei einem Kind mit Diabetes. Und es gibt Kinder, die nur mit einem Katheter auf die Toilette können. Da geht man dahin, wo sie gerade sind. Letztens habe ich im Wald bei Regen einen Katheter gelegt.»
Tabea Mantsch ist Pflegefachfrau und die stellvertretende Leiterin der Kinderspitex Biel-Bienne Regio. Sie parkiert ihr Auto vor einem Mehrfamilienhaus in einer kleinen Seeländer Gemeinde und drückt auf die Klingel. Im Wohnungseingang stellt sie ihre Tasche ab und zieht die Finken an. Dann geht sie in das Badezimmer, um sich die Hände zu waschen. Alles ist aufgeräumt und sauber, die Möbel sind aufeinander abgestimmt, die Wände dekoriert. Gedämpfte Klavierklänge tönen aus dem Wohnzimmer. Sie kommen aus einer Spieluhr, befestigt an einem grossen, weissen Wiegebett. Darin liegt der zweijährige Tian und schläft.
Tabea Mantsch geht zu ihm hin, spricht ihn an, hält seinen Kopf und hört zu, was die Mutter erzählt. In der Luft hängt der charakteristische Duft eines kleinen, warmen Körpers – es riecht nach Baby.
Tian ist schwer krank. Die letzten Tage waren schwierig. Der Zweijährige blutet an der Lippe, hat seit zwei Monaten ständig irgendwelche Infekte, die das ganze System von aufeinander abgestimmten Medikamenten durcheinanderbringen.
Tabea Mantsch wird sich die nächsten dreieinhalb Stunden um Tian kümmern, während die Mutter einkaufen geht und andere Dinge erledigt.
«Es war schwierig, Hilfe anzunehmen»
Mantsch arbeitet seit 2013 bei der Kinderspitex. Sie geht im ganzen Seeland und im Berner Jura zu Familien, um sie bei der Pflege von kranken Kindern zu unterstützen. Viele der Kinder haben sogenannte seltene Krankheiten, das sind Krankheiten, von denen auf 10 000 Personen weniger als fünf betroffen sind. Auch Tian hat eine seltene Krankheit; sie ist so selten, dass die Familie von keinem anderen Fall weiss. Eine Diagnose gab es erst, als er schon drei Monate alt war.
«Tian war ein Schreibaby, sodass der Fokus ganz dort war und wir zuerst gar nicht bemerkt haben, dass er sich nicht entwickelt», sagt die Mutter. Der Junge hat sehr wenig Energie und kann sich nicht bewegen – sein Kleinhirn wächst nicht richtig. Der vierjährigen Schwester, die gerne beim Umziehen und Wickeln hilft, fällt auf, dass andere Babys aktiver sind. Sie frage, wieso er nicht aufsteht. Zwar wisse sie, dass er krank ist, sagt die Mutter. «Aber wahrscheinlich denkt sie, dass es etwas wie eine Grippe ist, etwas, das vorbeigeht.»
Tian muss oft würgen und hat immer wieder Krämpfe – epileptische Anfälle; er sieht wahrscheinlich nichts, da sein Gehirn die Wahrnehmung nicht verarbeiten kann, und er kann nicht schlucken, weshalb er über eine Magensonde ernährt wird. Eigentlich würde an diesem Morgen eine Logopädin vorbeikommen und mit ihm ein Schlucktraining machen, doch mit den blutigen Lippen geht das nicht.
Tabea Mantsch ruft an und sagt den Termin ab. Es ist einer von unzähligen. Bei der Familie gehen Mitarbeitende des Entlastungsdienstes und der Frühförderung sowie Pflegende ein und aus. Die Kinderspitex kommt jeden Tag, ausser am Wochenende. Dazu zweimal nachts. Tian braucht alle vier Stunden etwas zu essen und er wird regelmässig umgelagert. Wenn die Kinderspitex den Nachtdienst macht, können die Eltern durchschlafen.
Die Mutter ist Fachfrau Gesundheit und hat früher im Spital gearbeitet. Es sei schwierig gewesen, Hilfe anzunehmen, sagt sie. Die Spitex verschafft ihr wertvolle Zeit für sich und für ihre Termine. «Gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gewissen, Tian abzugeben. Ich frage mich ständig, ob ich das Richtige mache als Mami.»
Zudem sei ihr bewusst, dass die Spitex unter Personalmangel leide, deshalb wolle sie sie nicht zu sehr beanspruchen, sagt Tians Mutter. Manchmal habe sie deshalb Hemmungen, um Unterstützung zu fragen. – «Immer fragen, fragen können Sie immer!», ruft Tabea Mantsch dazwischen.
Keine Privatsphäre mehr
Als Tabea Mantsch Tians Inhaliergerät vorbereitet, muss sie zuerst mehrere Schränke öffnen, bis sie findet, wonach sie sucht. Sie sei schon länger nicht mehr da gewesen, es sei wohl umgeräumt worden, erklärt sie. Das Inhaliergerät tönt ein wenig wie ein Generator.
Die Spitexmitarbeiterin fährt mit den Händen durch Tians dichtes Haar. Er muss inhalieren, damit seine Lunge nicht so anfällig für Infekte ist.
«Mein Mann und ich haben keine Privatsphäre mehr», wird Tians Mutter später sagen, wenn sie vom Einkaufen zurückkommt. «Aber wenn wir alles selber machen müssten, wären wir noch mehr am Anschlag.» Deshalb nähmen sie in Kauf, dass tagtäglich Leute bei ihnen ein und aus gehen.
Tabea Mantsch nimmt Tians Arm und bewegt ihn. Alle seine Gelenke werden mehrmals am Tag durchbewegt. Manchmal sperrt er sich dagegen, aber an diesem Tag nicht. Die Spitexmitarbeiterin nimmt Tians Hand und streicht damit über sein Gesicht. Sie, die sonst zielstrebig unterwegs ist und zackig die Strasse überquert, bewegt sich mit Tian langsam. Sie vermeidet kleine und schnelle Gesten, verwendet spezielle Griffe.
Am Anfang habe Tian nie gelacht, sagt sie. Jetzt lacht er.
Tabea Mantsch putzt ihm die Zähne, sie verabreicht ihm Nahrung, die vom Infusionsständer über den Schlauch und durch die Sonde in seiner Bauchwand in seinen Magen fliesst.

Er werde langsam gross, sagt Mantsch. «Man hat fast zu wenig Hände, um ihn gut zu stützen.»
Es ist Freitag. Am Freitag bereitet die Spitexmitarbeiterin jeweils alle Medikamente für das Wochenende vor. Tabea Mantsch sitzt am Esstisch, vor sich violette Spritzen, eine Liste und verschiedene Fläschchen.

Es soll nicht nach Spital aussehen
Wenn die Familie in die Ferien fährt, füllen allein die medizinischen Utensilien einen Koffer. Der organisatorische Aufwand ist riesig, denn für manche Medikamente braucht es eine ärztliche Bescheinigung, wenn man sie über die Landesgrenze ausführen will.
Mantsch zieht Spritze um Spritze auf und beschriftet sie mit einem schmalen Streifen.

Am Wochenende ist die Familie ungestört. Dann gibt es keine Besuche von Spitex, Logopädin oder Entlastungsdienst. «So haben wir auch einmal Zeit für uns», sagt die Mutter. Seit Tian auf der Welt ist, ist ihre Welt eine andere. Eine solche Diagnose sei ein Schock, sagt sie. «Man weiss auf einmal nicht mehr, wie die Zukunft aussieht.» Dann lerne man den Umgang damit. Ganz akzeptieren werde sie es wohl nie können, aber es werde einfacher, erträglicher. «Ich erlebe immer noch sehr schmerzhafte Momente, aber nicht mehr jeden Tag.»
Tian passt nur noch knapp auf den Wickeltisch. Wickeltisch, Wiegebett – sie strahlen eine Normalität aus, die Tians Mutter wichtig ist. Die Medikamente und Spritzen sind in einem Schrank versorgt. Bei ihr zu Hause solle es gemütlich und ordentlich sein. «Je mehr es nach Spital aussieht, desto mehr fühlt man sich selber krank.»
Sie dachte zuerst, diese Arbeit sei nichts für sie
Als Tabea Mantsch vor fast zehn Jahren ein Stelleninserat der Kinderspitex sah, dachte sie, das sei nichts für sie. Sie habe sich nicht vorstellen können, auf sich alleine gestellt zu arbeiten. Dann hat sie sich doch beworben. Zwar ist sie allein unterwegs, doch da ist der Austausch mit den anderen Spitexmitarbeiterinnen und der Kontakt mit den Familien. Morgens steigt sie zu Hause in Kappelen ins Auto und fährt zu den Einsätzen. Auf dem Radiodisplay leuchtet der Schriftzug «Canal 3 F». Die gebürtige Deutsche hört manchmal welsches Radio. Denn sie pflegt auch französischsprachige Kinder und braucht die Sprache. Jetzt ist die Lautstärke auf dem Minimum, während sie erzählt:
«Die Einsätze sind unregelmässig und wir müssen flexibel sein. Ständig kommen neue hinzu, auch Nachtdienste, es kann aber auch sein, dass ein Termin kurzfristig ausfällt, weil ein Kind ins Spital muss. Säuglinge, die eine Magensonde haben, ziehen sich oft den Schlauch aus der Nase. Das kann auch mitten in der Nacht passieren. Dann können die Eltern den Pikettdienst anrufen.
Wir begleiten ganz verschiedene Kinder. Es gibt einen 18-Jährigen, den wir seit 16 Jahren begleiten. Manche pflegen wir aber auch nur kurz. Im Sommer gibt es immer ein paar Kinder, die eine Borreliose-Infektion haben wegen eines Zeckenbisses. Diese brauchen 14 Tage lang intravenös Antibiotika, danach sehen wir sie nicht mehr. Normalerweise verweist das Spital die Eltern an uns. Man kann sich auch direkt bei uns melden, das passiert aber selten.»
Tabea Mantsch fährt zum achtjährigen Leon. Seine Eltern haben über das Spital von der Kinderspitex erfahren. Sie habe keine Ahnung gehabt, dass es das gibt, sagt die Mutter. Die Spitex ist zum ersten Mal bei der Familie.
Die Papiere im Hintergrund
Tabea Mantsch sitzt mit den Eltern am Küchentisch und holt Formulare hervor. Grösse, Gewicht, wie gut die Augen sind und der Hörsinn – all das muss die Spitexmitarbeiterin erfassen. Wie ist die Verdauung? Gibt es kognitive Einschränkungen? Tabea Mantsch fotografiert Leons Stundenplan.
Es entsteht eine Ahnung von den Papierbergen, die sich hinter einem Spitexbesuch stapeln: Bedarfsabklärung, Einsatzplanung, Leistungserfassung, neue Bedarfsabklärung, Rechnungsstellung. Die Kinderspitex muss klären, von wem ihre Leistungen bezahlt werden, und sie muss jeden ihrer Einsätze dokumentieren.
Bei Leon ist der Fall ziemlich klar: Die Mutter erzählt, dass auf der Schlittschuhbahn der Tissot Arena eine Frau in Leon gefahren und mit einer Drehung auf ihn gefallen ist. Die Folge: ein offener Bruch am rechten Unterschenkel und fünf Tage Spital. Aus Leons Schienbein ragen nun vier lange Schrauben, an den Enden verbunden durch ein Metallgestell, den sogenannten Fixateur extern.

Die Eintrittsstellen der Schrauben sowie die Wunde müssen anfangs täglich gereinigt und versorgt werden. Die Mutter verzieht das Gesicht: Das könne sie nicht sehen. «Ich wurde selber noch nie operiert, habe noch nie etwas gebrochen. Das war alles etwas viel für mich.»
Leon liegt im Bett, auf der Brust ein Tablet, während Tabea Mantsch neben ihm kniet und mit routinierten Bewegungen den Verband abrollt. Der Achtjährige schaut lieber aufs Tablet als auf sein Bein. «Kannst du die Zehen bewegen?», fragt Tabea Mantsch. Leon bewegt seine Zehen. «Ich habe nur zwei Minuten geweint», sagt er. Dann schaut er doch neugierig hinter dem Tablet hervor: «Mama, wie weit schaute der Knochen raus?» – Fünf Zentimeter, lautet die Antwort.
Tabea Mantsch reinigt die Wunden mit Tupfern und Pinzetten, die sie selbst mitgebracht hat. «Die vergessen sie im Spital gerne mitzugeben», sagt sie. Sie hat deshalb einen Vorrat im Auto.
Leon wird verschiedene Spitexmitarbeiterinnen kennenlernen. Sie werden bald nur noch alle zwei Tage kommen und dann alle drei. Bis schliesslich die Eltern die Pflege selbst übernehmen.

Über den Tod sprechen
Die Spitexmitarbeiterinnen gehören zum Alltag und sind doch nicht Teil der Familie. Tabea Mantsch übernachtet bei Kindern, aber siezt die Mütter; sie streichelt die Kinder, aber sie isst normalerweise nicht mit der Familie am Tisch und sie geht nicht an die Kindergeburtstage.
«Ich glaube, dass ich mich gut abgrenzen kann. Aber es gibt schon Sachen, die ich heimnehme. Im Oktober sind drei Kinder gestorben. Das ist viel. Wenn die Familien das möchten, gehen enge Bezugspersonen der Spitex an die Beerdigung.
Belastend ist es für mich, wenn ein Kind in schwierigen sozialen Verhältnissen lebt oder wenn es nicht genügend Unterstützung bekommt. Es ist nicht mein Auftrag, ein Kind zu erziehen. Ich schaue aber immer auf die ganze Familie und versuche zu beraten.
Dann gibt es verschiedene kulturelle Herausforderungen. In manchen Familien darf man nicht über den Tod sprechen. Es heisst dann, wer über den Tod spricht, gebe die Hoffnung auf. Unter solchen Umständen ist die Palliativbegleitung schwierig. Kinder wissen, wie schwer krank sie sind, und sie wollen vielleicht über das Sterben sprechen, haben aber niemanden zum Reden. Das ist schwer auszuhalten. Ich sage jeweils, dass ich das Thema nicht selbst anspreche, aber, dass ich nicht leugne, wenn mich das Kind danach fragt.
Mit Kindern kann man meistens gut über den Tod sprechen, besser als mit den Eltern. Vielleicht gab es schon mal eine Begegnung mit dem Tod, die sie verarbeitet haben, etwa wenn der Hamster gestorben ist. Kinder sind da unkomplizierter, für sie ist das kein Tabu. Aber sie merken, wenn es für die Eltern eines ist.»
- ZUR KINDERSPITEX
- Die diplomierten Pflegefachpersonen besuchen Familien in Biel, dem Seeland und dem Berner Jura. So hilft die Kinderspitex mit, Spitalaufenthalte zu verkürzen oder zu vermeiden.
- Die Spitexmitarbeitenden haben täglich von 6 Uhr bis 23 Uhr Einsätze, machen Nachtdienste und einen Pikettdienst. Die Leistungen werden auf ärztliche Verordnung erbracht und von der Krankenkasse oder der Invalidenversicherung bezahlt.
- Die Kinderspitex arbeitet eng mit den Kinderkliniken, Kinder- und Hausärzten, der Mütter- und Väterberatung sowie anderen Spezialisten und Institutionen zusammen.
- Die Kinderspitex Biel-Bienne Regio betreut gegen 100 Kinder und Jugendliche pro Jahr.